The Royal Navy and the German Threat 1901-1914 —— Admiralty Plans to Protect British Trade in a War Against Germany
----- 皇家海军和德国的威胁,1901-1914
Introduction 1. Handelskrieg gegen England: German Plans to attack British Commerce in an Anglo-German War 2. Uncovering the Plan: British Intelligence on German Intentions 3. The Dawn of the Lusitania: Germany's Fighting Liners and the Cunard Agreement of July 1903 4. A 'Fighting Cruiser' to Hunt 'the German Greyhounds': The Origins of HMS Invincible Revisited 5. Testing Jurisprudence: Slade's Battle to Change the Laws of War at Sea 6. Establishing a Global intelligence System 7. Churchill's DAMS Epilogue Conclusion Bibliography Index
{{comment.content}}

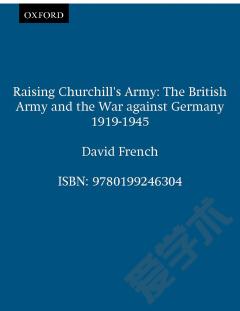
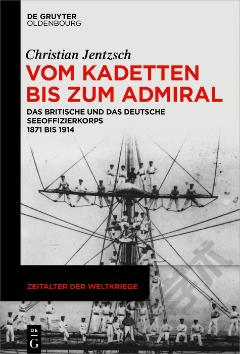
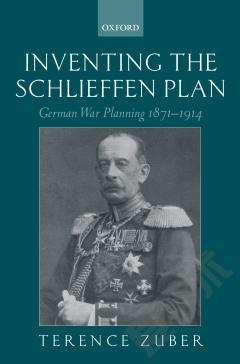




 京公网安备 11010802027623号
京公网安备 11010802027623号